Löschung aus polizeilichen Datenbanken
Wird ein Ermittlungsverfahren mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt, endet damit die strafprozessuale Verfolgung. Für die betroffene Person gilt die Unschuldsvermutung (Art. 6 Abs. 2 EMRK). Dennoch bleiben ihre Daten oft in polizeilichen Verbund- oder Landesdatenbanken gespeichert – manchmal über Jahre. Bei einer Routinekontrolle kann ein Polizeibeamter dann sehen, dass die Person „vormals Beschuldigter“ war. Solche Informationen können Einfluss auf polizeiliche Entscheidungen nehmen und sich für die Betroffenen nachteilig auswirken.
Dieses Thema hat aktuell besondere Relevanz, da das Bundesverfassungsgericht im vergangenen Jahr Teile des Bundeskriminalamtsgesetzes (BKAG) für verfassungswidrig erklärt hat. Die Entscheidung betrifft insbesondere die vorsorgliche Speicherung personenbezogener Daten von Beschuldigten im polizeilichen Informationsverbund (BVerfG 1 BvR 1160/19). Im Anschluss daran hat der Gesetzgeber die Vorschriften überarbeitet und neue Regelungen zur Datenspeicherung, Speicherdauer und Überwachung von Kontaktpersonen beschlossen. Die politische und gesetzgeberische Entwicklung zeigt, dass Fragen rund um Löschungs- und Auskunftsansprüche von Betroffenen auch auf Bundesebene zunehmend an Bedeutung gewinnen.
In unserer dreiteiligen Serie zeigen wir, wie Betroffene ihre Löschungsansprüche gegen Strafverfolgungsbehörden erfolgreich geltend machen können und worauf es bei der Argumentation im Einzelnen ankommt. Soweit es um landesgesetzliche Regelungen geht, stellen wir die Vorgaben in NRW dar.
Erfassung in der polizeilichen Vorgangsverwaltung
Sobald eine Person – ob als Zeuge oder als Beschuldigter – an einem polizeilichen Vorgang beteiligt ist, werden die personenbezogenen Daten in das polizeiinterne Vorgangsverwaltungssystem „ViVA“ eingepflegt. Nach Abschluss der ersten polizeilichen Ermittlungen übergibt die Polizei den Vorgang an die Staatsanwaltschaft. Diese wiederum arbeitet mit eigenen Datenerfassungssystemen. Ein automatisierter Austausch findet nicht statt.
Nach Abschluss der Ermittlungen ist die Staatsanwaltschaft nach § 482 StPO, MiStrA Nr. 11 verpflichtet, die Polizeibehörde über den Ausgang des Verfahrens (Urteil, Beschluss oder Entschließung der Staatsanwaltschaft) zu informieren. Für die Polizei folgt aus der Mitteilung der Verfahrenserledigung die Pflicht zur Prüfung, ob in dem Verfahren gespeicherte Daten gelöscht werden müssen oder weiter gespeichert bleiben dürfen.
Auskunft
Bevor Daten verschwinden können, muss sichtbar werden, welche überhaupt gespeichert sind: Die Auskunft ist der erste Schritt zur Löschung. Der Auskunftsanspruch in NRW ergibt sich aus § 49 DSG NRW. Betroffene können ihr Auskunftsersuchen einschließlich Identifikationsnachweis an die speichernde Polizeibehörde bzw. – sofern diese Information fehlt - an das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste richten. Letztere gibt Auskunft darüber, welche Polizeibehörde in NRW die personenbezogenen Daten gespeichert hat.
Die Polizeibehörden können die Datenauskunft unter den Voraussetzungen des § 48 Abs. 2 DSG NRW verweigern oder einschränken, § 49 Abs. 4 DSG NRW. Dies ist unter anderem dann möglich, wenn die Datenauskunft weitere Ermittlungen gefährden oder eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen würde. Hierbei hat die Behörde eine Abwägung zwischen dem Auskunftsinteresse des Betroffenen und ihrem Geheimhaltungsinteresse vorzunehmen.
Ein Auskunftsanspruch über bundesweit gespeicherte Daten ergibt sich aus § 84 Abs. 1 BKAG. Damit können Betroffene ein umfassendes Bild über die potenziell gespeicherten Daten im gesamten Bundesgebiet erhalten. Das gilt jedoch nicht uneingeschränkt. Stellt die Auskunftserteilung etwa eine Gefahr für die Aufgabenerfüllung, für die öffentlichen Sicherheit oder für Rechtsgüter Dritter dar und überwiegt das Informationsinteresse nicht, kann die Auskunftserteilung nach § 84 Abs. 1 BKAG iVm §§ 57 Abs. 4, 56 Abs. 2 BDSG unterbleiben oder eingeschränkt werden. Aus § 57 Abs. 6 BDSG ergibt sich ein Anspruch des Betroffenen auf unverzügliche, schriftliche und begründete Mitteilung der Auskunftsverweigerung oder -beschränkung.
Löschung
Bei einem rechtkräftigen Freispruch, einer unanfechtbaren Ablehnung der Eröffnung des Hauptverfahrens oder endgültigen Verfahrenseinstellung, ist eine Datenspeicherung grundsätzlich unzulässig, wenn sich aus den Gründen der Entscheidung ergibt, dass die betroffene Person die Tat nicht oder nicht rechtswidrig begangen hat (§ 22 Abs. 3 Satz 1 PolG NRW). Liegt hingegen ein sogenannter „Restverdacht“ vor, kann die Speicherung dennoch zulässig sein. Begründet wird dies damit, dass der Verdacht einer Straftat trotz Verfahrenseinstellung fortbestehen kann, sodass eine Speicherung zur Wahrung möglicher zukünftiger Strafverfolgungsinteressen noch erforderlich sein kann. Diesbezüglich ist dann jedoch erforderlich, dass Gewicht und Grad des Verdachts eine Fortspeicherung rechtfertigen (§ 22 Abs. 3 Satz 2 PolG NRW). Bei einer eine Einstellung des Ermittlungsverfahrens mangels Tatverdachts nach § 170 Abs. 2 StPO besteht also nicht zwingend ein Anspruch auf Datenlöschung.
Nach Erhalt der Einstellungsnachricht lohnt es sich demnach, Akteneinsicht zu beantragen und Einsicht in die Ermittlungsakte zu nehmen, um das Vorliegen von Gründen für einen Löschungsanspruch zu prüfen.
Kontaktieren Sie uns:




 WirtschaftsWoche Auszeichnung im Steuerstrafrecht
WirtschaftsWoche Auszeichnung im Steuerstrafrecht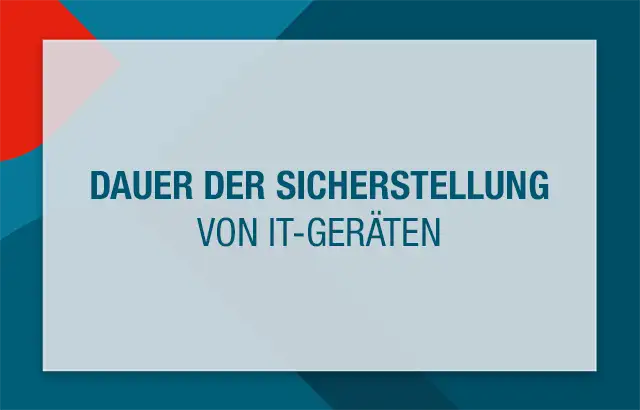 Dauer der Sicherstellung von IT-Geräten
Dauer der Sicherstellung von IT-Geräten