Sicherstellung von IT-Geräten: Wie lange darf die Polizei Ihre Geräte behalten?
Wenn die Polizei plötzlich in der Wohnung steht und Laptop, Smartphone oder Festplatte mitnimmt, ist das erst einmal Schock. Doch was passiert danach? Wie lange dürfen die Ermittlungsbehörden Ihre Geräte behalten – und müssen Sie wirklich Passwörter herausgeben? Hier erfahren Sie praxisnah, welche Rechte Sie haben, wo die Grenzen der Ermittlungsbefugnisse liegen und wann Sie Anspruch auf die Rückgabe Ihrer Geräte haben.
Das Wichtigste im Überblick
- Keine Offenbarungspflicht: Beschuldigte müssen Passwörter niemals herausgeben – die Polizei darf jedoch vorhandene Passwörter nutzen oder Entschlüsselungssoftware einsetzen.
- Eingeschränkte Zeugenpflicht: Zeugen können zur Herausgabe fremder Passwörter verpflichtet sein, müssen für die Vernehmung aber keine Unterlagen vorbereiten oder mitbringen.
- Begrenzte Dauer: Die Sicherstellung darf nur so lange dauern, wie sie für die Auswertung notwendig ist.
- Überlange Sicherstellung ist rechtswidrig: Wenn Ihr Laptop oder Handy unbearbeitet bei der Polizei liegt, können Sie ggf. die Herausgabe verlangen.
Teil 1: Zugriff auf sichergestellte IT-Geräte – Passwörter, Entsperrung und rechtliche Grenzen
Die Sicherstellung von IT-Geräten gehört zum Ermittlungsalltag – ob bei Steuerdelikten, Cybercrime oder Betrug. Ermittlungsbehörden nutzen diese Geräte, um Beweise zu sichern, Daten zu analysieren und den Tatvorwurf zu überprüfen. Doch für Betroffene ist oft unklar, welche Rechte und Pflichten sie bei der Durchsuchung oder Beschlagnahme haben Im Folgenden werden die wichtigsten Fragen praxisnah beantwortet.
Muss ich als Beschuldigter die Passwörter für meinen Laptop und mein Smartphone der Polizei mitteilen?
Nein, als Beschuldigter dürfen Sie schweigen. Die Strafprozessordnung schützt Beschuldigte vor einer Selbstbelastungspflicht. Niemand ist verpflichtet, durch die Mitteilung von Passwörtern zur eigenen Überführung beizutragen. Die Polizei darf jedoch gefundene Passwörter verwenden (z. B. wenn sie auf Zetteln notiert oder auf Geräten oder in Clouds gespeichert sind) und auf technische Mittel zurückgreifen. Wenn keine Passwörter verfügbar sind, greifen Ermittlungsbehörden häufig auf Entschlüsselungssoftware zurück. Nicht erlaubt ist, einen Beschuldigten zur Herausgabe oder zur Eingabe des Passworts zu zwingen.
Muss ich als Zeuge die Passwörter für den Laptop und das Smartphone eines anderen der Polizei mitteilen?
Etwas anders sieht es für Zeugen aus. Wer Passwörter von Dritten kennt, kann zur Mitteilung verpflichtet sein, jedoch nur, wenn das Passwort tatsächlich bekannt ist und kein eigenes Auskunftsverweigerungsrecht (§ 55 StPO) besteht. Niemand muss also extra Nachforschungen anstellen oder Dokumente zusammensuchen. Nur vorhandenes Wissen zählt.
Darf die Polizei mein Gerät „knacken“?
Grundsätzlich ja – mit technischen Mitteln. Ermittlungsbehörden verfügen über spezialisierte IT-Abteilungen, die sogenannte Forensik-Software einsetzen, um verschlüsselte Geräte zu entschlüsseln oder Passwörter zu rekonstruieren. Voraussetzung ist die rechtmäßige Sicherstellung. Wenn die Polizei rechtmäßig Zugriff auf das Gerät hat, darf sie auch versuchen, es zu entsperren. Die Ermittler setzen Verfahren wie Brute-Force-Angriffe oder Kryptanalyse ein. Diese Maßnahmen müssen verhältnismäßig sein. Das bedeutet, Aufwand, Eingriffstiefe und Tatvorwurf müssen im Verhältnis stehen. In der Praxis sind starke Passwörter oft ein erhebliches Hindernis. Entsprechend dauern Auswertungen häufig viele Wochen oder Monate.
Kann die Polizei den Entsperrcode für ein Smartphone knacken?
Nach der aktuellen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (2 StR 232/24), ist das zwangsweise Entsperren eines Smartphones durch Auflegen des Fingers des Beschuldigten auf den Fingerabdrucksensor grundsätzlich zulässig, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen der §§ 102, 81b, 110 und 94 StPO erfüllt sind.
Voraussetzungen dafür ist eine rechtmäßige richterliche Durchsuchungsanordnung, die ausdrücklich auch das Auffinden von Mobiltelefonen umfasst. Hierbei ist ein konkreter Bezug zwischen Tat und Gerät notwendig „Auffindevermutung“. Der Eingriff darf sich nur auf Informationen beziehen, die zur Aufklärung der konkret untersuchten Straftat erforderlich sind.
Das zwangsweise Entsperren des Geräts durch Auflegen des Fingers auf den Sensor wird auf § 81b Abs. 1 StPO gestützt. Diese Vorschrift erlaubt körperliche Maßnahmen gegenüber Beschuldigten, wenn sie zur Durchführung des Strafverfahrens notwendig sind. Zulässig ist das nur, wenn ein konkreter Anfangsverdacht hinsichtlich einer rechtswidrigen Tat besteht und wenn die Maßnahme nicht außer Verhältnis zur Schwere dieser Tat steht.
Teil 2: Dauer der Sicherstellung bis zur Rückgabe der IT-Geräte
Nach der Mitnahme von IT-Geräten beginnt die eigentliche Herausforderung: die Auswertung. Viele Beschuldigte erleben, dass ihre Computer, Handys oder Server über Monate oder gar Jahre bei der Polizei bleiben. Aber die Polizei hat keinen Freibrief für eine endlose Sicherstellung.
Wie wertet die Polizei die sichergestellten IT-Geräte aus?
Der Ablauf sieht typischerweise so aus:
- Sicherung: Erstellung forensischer Kopien („Images“) der Datenträger; Dokumentation der Speicherinhalte, Ordnerstrukturen und Dateigrößen.
- Forensische Analyse: Untersuchung relevanter Dateien, etwa E-Mails, Chats, Cloud-Daten und Logdateien; Rekonstruktion gelöschter oder verschlüsselter Daten.
- Auswertung: IT-Forensiker erstellen Berichte, die später in die Ermittlungsakte einfließen.
Die Behörden sind verpflichtet, zügig zu arbeiten, um Eigentumsrechte und berufliche Interessen der Betroffenen nicht übermäßig zu beeinträchtigen.
Wie lange dauert die Auswertung der sichergestellten IT-Geräte?
Die Dauer der Sicherstellung hängt von mehreren Faktoren ab:
- Datenmenge: Große Datenträger oder komplexe Serverstrukturen benötigen mehr Zeit.
- Technische Hürden: Verschlüsselungen, defekte Datenträger oder proprietäre Systeme verzögern die Auswertung.
- Ausstattung der Behörde: Manche Landeskriminalämter sind chronisch überlastet, was zu monatelangen Verzögerungen führt.
Trotzdem rechtfertigt eine Überlastung der Behörden keine Verzögerung. Das Landgericht Bonn hat dies im Beschluss vom 30.09.2024 (777 Js 219/23 SE) ausdrücklich klargestellt: „Eine derart verzögerte Bearbeitung durch unzureichend ausgestattete staatliche Organe vermag einen deutlich über sechs Monate hinwegdauernden Eingriff in Eigentumsrechte des Betroffenen nicht zu rechtfertigen.“ Frühere Rechtsprechung hielt bereits Zeiträume von zwei bis drei Monaten für unverhältnismäßig lang. Heute sind Gerichte zurückhaltender – doch nach einem Jahr wird eine weitere Sicherstellung regelmäßig kritisch gesehen.
Wann bekomme ich die sichergestellten IT-Geräte zurück?
Sobald die Ermittler eine komplette Kopie aller gespeicherten Daten erstellt oder die für das Verfahren relevanten Daten ausgewählt und kopiert haben, müssen sie die Geräte freigeben. Denn die Geräte selbst sind in der Regel kein Beweismittel im Verfahren. Nur wenn der Verdacht besteht, dass ein Gerät zur Begehung der Tat genutzt wurde, kann es als Einziehungsgegenstand einbehalten werden.
Betroffene sollten nicht zögern, anwaltlich gegen überlange Sicherstellungen vorzugehen. Wenn Ihre IT-Geräte sichergestellt wurden oder Sie Fragen zur Rechtmäßigkeit und Dauer der Maßnahme haben, wenden Sie sich an die Kanzlei Tsambikakis. Unsere Kanzlei ist auf IT-Strafrecht und digitale Beweismittel spezialisiert. Wir prüfen für Sie:
- ob die Sicherstellung rechtmäßig war,
- ob die Dauer der Auswertung verhältnismäßig ist,
- und wie Sie die Herausgabe Ihrer Geräte durchsetzen können.
Warten Sie nicht, bis Wochen zu Monaten werden. Eine frühzeitige anwaltliche Intervention beschleunigt das Verfahren und schützt Ihre Daten, Ihr Eigentum und Ihre Privatsphäre.
Häufig gestellte Fragen
1. Was bedeutet „Sicherstellung von IT-Geräten“ überhaupt?
Strafverfolgungsbehörden nehmen Computer, Smartphones oder Datenträger vorübergehend in polizeilichen Gewahrsam, um Beweise zu sichern. Die Maßnahme dient nicht der Wegnahme, sondern dem Erhalt und der Auswertung von Beweismitteln.
2. Muss ich der Polizei mein Passwort oder Entsperrcode mitteilen?
Nein, als Beschuldigter nie. Das folgt aus dem Grundsatz, dass sich niemand selbst belasten muss. Die Polizei darf jedoch aufgefundene Passwörter nutzen oder Entschlüsselungssoftware einsetzen.
Kontaktieren Sie uns, bevor Sie Aussagen machen oder Passwörter herausgeben.
3. Kann die Polizei mein Smartphone oder meinen Laptop auch ohne Passwort auswerten?
Ja, Ermittlungsbehörden verfügen über spezielle forensische Software, die verschlüsselte Geräte analysieren oder Daten extrahieren kann. Allerdings ist der technische Aufwand hoch und nicht jedes Passwort kann geknackt werden.
4. Wie lange darf die Polizei meine IT-Geräte behalten?
Nur so lange, wie die Sicherstellung für das Ermittlungsverfahren erforderlich ist. Der überlange Entzug der Geräte – insbesondere über mehr als sechs Monate – kann unverhältnismäßig und rechtswidrig sein.
5. Wie läuft die Auswertung der sichergestellten Geräte ab?
Zunächst erfolgt eine vorläufige Sicherstellung zur Durchsicht der Geräte. Dabei prüfen Ermittler, welche Daten für das Strafverfahren relevant sind. Im Anschluss erfolgt die endgültige Sicherstellung der Daten. Für die nachfolgende Auswertung werden forensische Kopien erstellt.
6. Was kann ich tun, wenn die Sicherstellung zu lange dauert?
Die Kanzlei Tsambikakis & Partner ist auf IT-Strafrecht und digitale Beweismittel spezialisiert. Wir prüfen:
- die Rechtmäßigkeit der Mitnahme Ihrer IT-Geräte,
- die Verhältnismäßigkeit der Dauer der Sicherstellung,
- und setzen Ihr Recht auf Herausgabe durch.
Kontaktieren Sie uns:




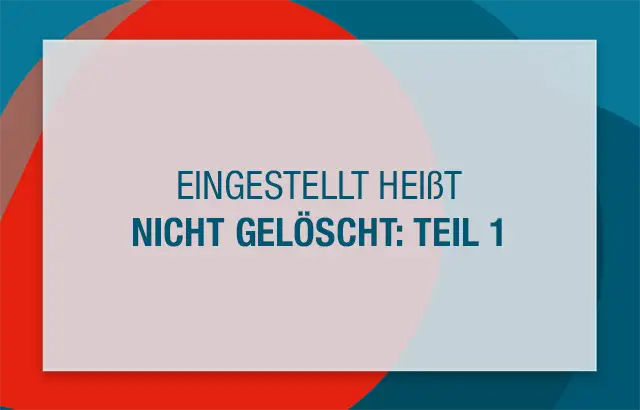 Eingestellt heißt nicht gelöscht, Teil 1
Eingestellt heißt nicht gelöscht, Teil 1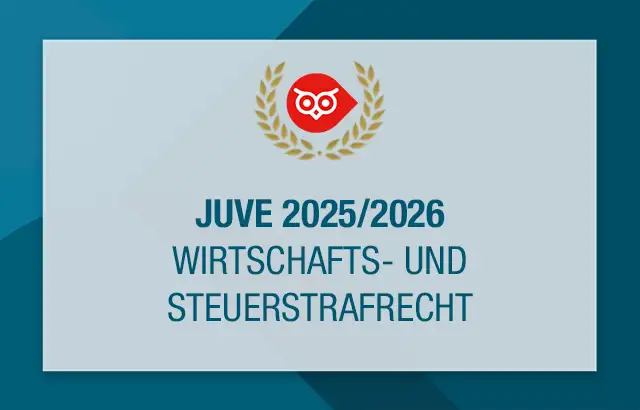 JUVE: Ausgezeichnet im Wirtschafts- und Steuerstrafrecht
JUVE: Ausgezeichnet im Wirtschafts- und Steuerstrafrecht